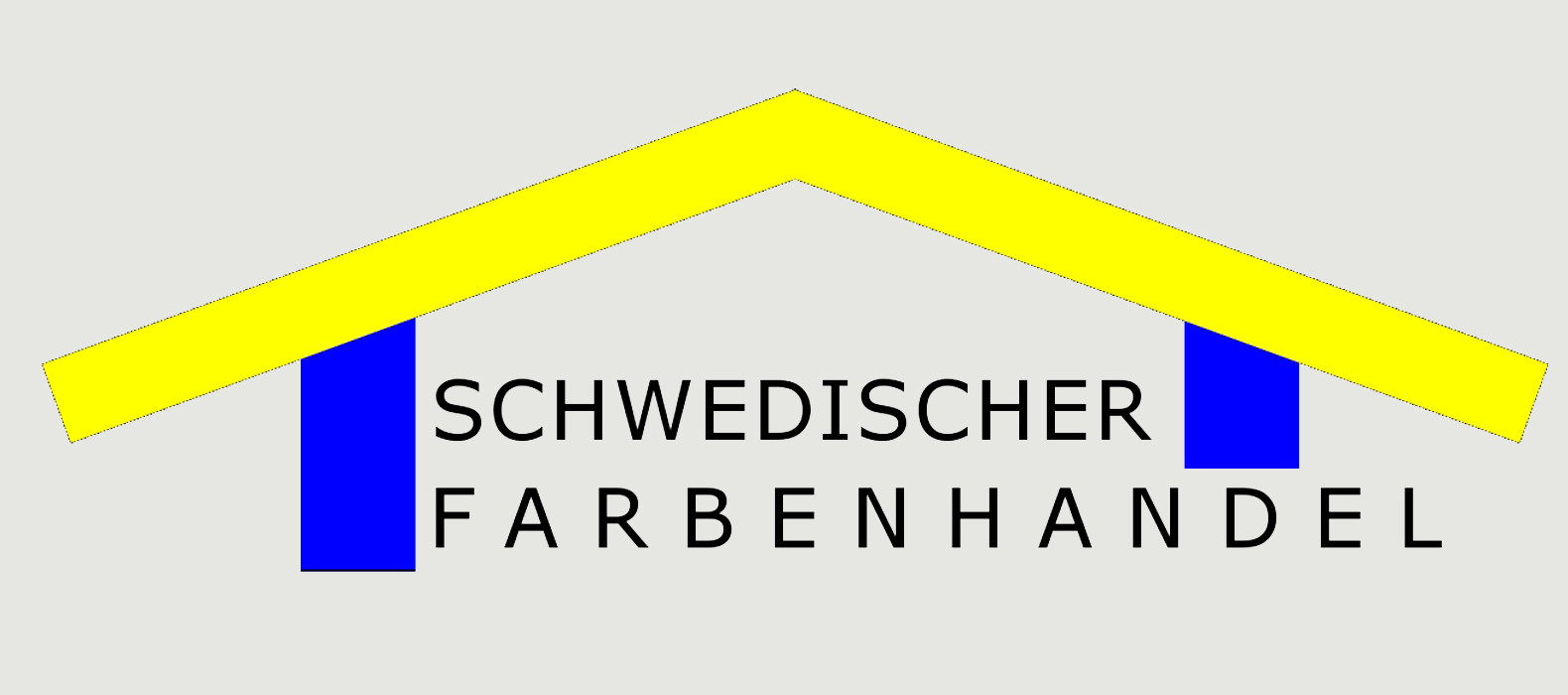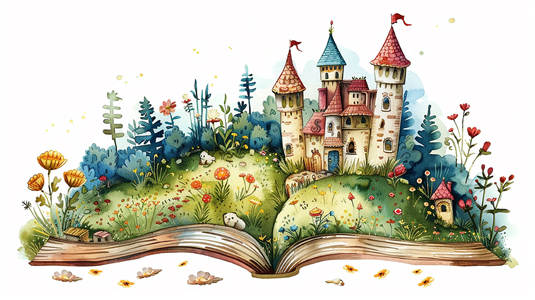Märchenstunde - Mythen und Hörensagen zu Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich
In vielen Ländern Europas, so auch im deutschsprachigem Raum, gibt es sehr viele Falschinformationen rund um das Thema "Farbanstriche". Wir klären an dieser Stelle ganz sachlich und ohne Verweise auf unser Sortiment darüber auf, was an den Stories stimmt und was nicht. Es ist alles erklärbar und kein Hexenwerk, das meiste ist rein physikalisch zu verstehen...

An- oder abschleifen, sofort oder später streichen, dünn oder dick auftragen, Lasur oder deckende Farbe?
Jeder erzählt etwas anderes, kaum jemand hat aber den Durchblick. Es ist wie bei der Wahl der richtigen Hautcreme: nur weil diese bei mir gut ist, muss sie nicht bei jedem anderen Menschen die richtige sein.
Nur weil meine Automarke für meine Zwecke die richtige ist, muss sie nicht dem Nachbarn passen.
Schauen wir uns doch jetzt Mal die Klassiker unter den "Empfehlungen" an, die so in aller Munde sind.
Neues Holz muss sofort gestrichen werden - am besten sogar noch vor der Montage
Viele Hölzer sind heute im Auslieferungszustand sehr glatt gehobelt, glänzen dadurch sogar. Machen Sie auf dieses Holz doch Mal einen Tropfen Speiseöl aus der Küche und stoppen Sie die Zeit, wie lange diese Stelle ölig bleibt, weil eben jenes öl nicht ins Holz eindringt. Sie werden erstaunt sein, wie lange das dauern kann. Alles unter 20-30 Minuten ist ok, dann kann gestrichen werden. Alles darüber bedeutet: ungestrichen bewittern lassen, bis das Holz aufnahmefähig geworden ist.
Wenn man Holz im Außenbereich streicht, muss der erste Anstrich eine Verbindung mit dem Holz eingehen, sonst bleibt er auf der Oberfläche und löst sich kurzerhand wieder. Sonst könnte man auch Tesafilm aufs Holz kleben.
Tatsächlich ist das gehobelte Holz durch die Verdichtung der Reibungshitze des Hobels bereits geschützt vor Nässe. Ja, es geht nur um die Nässe durch Regen und Luftfeuchtigkeiten. Perlt obiges Öl ab, perlt Nässe erst recht ab.
Anders gesagt: können Sie Ihre Hände mit einer Handcreme eincremen, wenn diese nicht einziehen kann? Weil die Haut glänzt oder weil Sie noch Gummihandschuhe tragen?


Das Holz muss zuerst vor Bläue / Blauschimmel geschützt werden, bevor ein Schutzanstzrich folgt
In den 1950er Jahren wurde durch eine DIN-Verordnung festgelegt, daß man als Holzhändler dem Kunden den Hinweis geben muss, dieser möge sein Holz vor dem unbekannten Pilz (der das Holz bläulich-schwarz färbt) mittels chemischer Substanzen schützen. Seit den 1990er Jahren ist der Pilz erforscht, gilt als harmlos für das Holz und tritt bestenfalls bei schwüler Wetterlage auf - und dann auch nur bei Fichte oder Tanne. Es kommt nicht zur Fäulnis, nur zur Verfärbung.
Pilze gedeihen auf Holz, wenn dieses dauerhaft feucht ist und ausreichend Wärme vorhanden ist. In den ersten Jahren können Pilze auf dem blanken/unbehandelten Holz nur oberflächlich Halt finden und sind leicht abwaschbar. Ein Bläueschutzmittel (trügerisch: manche werden mit der Ergänzung "grund" wie "Bläueschutzgrund" tituliert) liegt nach der Behandlung auf der Holzoberfläche und ist bereits nach wenigen Tagen wirkungslos.
Wenn das Holz mit einem wasserabweisenden Anstrich versehen wurde, gibt es keinen Bläuebefall. Sparen Sie viel Geld & Zeit, indem Sie auf diese sinnbefreiten Anstriche verzichten. Betreiben Sie keine Holzschutzprophylaxe. Sie cremen sich ja auch nicht mit Sonnencreme im Dezember ein, weil Sie evtl. im Juli einen Sonnenurlaub planen, oder?
Lasuren ziehen ins Holz ein und deckende Farbe blättert ab
Eine sehr oft anzutreffende Blindaussage vor allem im Internet. Gehen wir auf die beiden "Informationen" dieser pauschalisierten Auskunft getrennt nach:
Lasur zieht ins Holz ein.
Nein, in 90% aller Fälle nicht. Wenn etwas ins Holz einziehen soll, muss es langsam trocknen und Stoffe enthalten, die penetrierend sind. Wasserbasierende Lasuren sind z.B. nach 10-20 Minuten bereits fast trocken. Diese Trocknung findet zwangsläufig auf der Oberfläche des Holzes statt. Oft ist in den Wasserlasuren das Bindemittel Acryl/Acrylat enthalten. Dieses Plastik ist zu grobmolekular und zieht schon mal gar nicht in ein Holz ein. Es wäre so, als würde man statt einer Handcreme einen flüssigen Klebstoff auf die Haut reiben.
Lösemittel wie Terpentinersatz lassen den Anstrich etwas langsamer trocknen, jedoch sind dann die Bindemittel wie Alkydharze enthalten, die molekular recht langkettig sind und mitunter nur 1/10mm in die Holzoberfläche eindringen - immerhin tiefer als das Plastik Acryl oder Acrylat. Erkennbar ist das Einziehen daran, daß der erste Anstrich ungleichmäßigen Glanz hat. Wo es matt ist, befindet sich kein Schutzfilm auf der Oberfläche sondern ist dieser tatsächlich leicht ins Holz eingedrungen.


Wenn deckende Farbe angeblich immer abblättern soll:
Warum streichen die Skandinavier keine Lasuren auf Ihre Häuser sondern nur deckende Farben?
Egal was man auf das Holz streicht, es muss eine Verbindung eingegangen werden. Zieht das oben erwähnte Speiseöl nicht ins Holz ein, macht das Anstreichen des Holzes auch keinen Sinn - weder mit Holzöl, noch mit Lasur oder Farbe. Es wird auch nicht imprägniert oder grundiert, nichts macht dann einen Sinn. Wer dennoch das neue und gehobelte Holz sofort streicht, wird ein tagelang klebendes Holzöl und abblätternde Lasur oder Farbe erleben.
Wenn die Handcreme nicht in die Haut einzieht und darauf nur schmiert, hat man wohl noch die Gummihandschuhe an - oder kurz zuvor bereits die Haut eingecremt.
Pauschale Aussagen zu Holzanstrichen ohne das entsprechende Wissen dahinter... Hinterfragen Sie solche Aussagen immer. Richtig verarbeitet hält eine deckende Farbe etwa 10x länger als eine Lasur.
Abschließend: Abblätterungen gibt es sowohl bei Lasuren als auch bei deckenden Farben. Während eine Lasur nach 6-24 Monaten verwittert ist und nicht mehr existiert (im UV-Licht der Sonne zersetzt ist), fällt es bei einer dann noch vorhandenen Farbschicht auf, wenn diese mangels Verbindung zum Holz (falsch grundiert oder/und das glatte Holz zu früh gestrichen) sich nach 1-3 Jahren abschält. Farbe verwittert auch im Sonnenlicht, ist aber in ihrer Schichtstärker viel dicker. Daher hält sie auch länger als eine Lasur, braucht jedoch eine richtige Grundierung im Holz.
In Skandinavien kennt man das abblättern von Farbe nicht, dort achtet man auf die Spielregeln zwischen Holz&Farbe.
Bei Renovierungsanstrichen muss der Altanstrich immer zuvor geschliffen werden
Schleifpapier wurde um ca. 1850 erfunden. Es wurde damals entwickelt, um Anstriche zu entfernen, die schadhaft sind bzw. um Ungleichmäßigkeiten in Oberflächen zu glätten.
Früher gab es nur eine geringe Anzahl an Farbarten, meistens benutzte man Farben auf Basis von pflanzlichen Ölen wie z.B. Leinöl. Die heute bekannten Bindemittel wie Acryl, Acrylat oder Alkydharz gab es zu der damaligen Zeit noch nicht. Leinölfarbe kann nicht abblättern, da sie eine Eigenpenetration ins besitzt. Hautcreme kann auch nicht von der Haut abblättern, weil sie in eben jene einzieht.
Heute wird gerne von Malern behauptet, man müsse den intakten Altanstrich anschleifen, bevor man einen Renovierungsanstrich macht. Das hat man vor 1850 nicht gemacht und ist auch heute noch in den meisten Fällen nicht zielführend. Wenn z.B. der alte Anstrich intakt ist und entsprechend gesäubert wurde, wird mit der gleichen Farbart einfach direkt drüber gestrichen.
Besonders tragisch wird es, wenn der Altanstrich eine Vollacrylatfarbe ist. Schleift man diese an, ist das Schleifpapier sofort mit dem durch die Reibungshitze aufgeweichten Plastik zugeschmiert und nicht mehr zu verwenden.


Das am häufigsten vorgebrachte Argument ist, daß "durch das Anrauen/Anschleifen der alten Farbschicht die neue Farbschicht besser anhaftet". Wenn es die gleiche Art von Farbe wie zuvor ist, ist das Anschleifen komplett unnötig. Ist der Renovierungsanstrich ein anderer Typ von Farbe mit anderer Bindemittelzusammensetzung, dann achtet man lediglich auf die Reihenfolge, was man auf welchen Voranstrich aufträgt. Acryl/Acrylat auf Öl- oder Alkydharzfarbe ist unkritisch, umgekehrt zumeist der Grund, wenn sich eine Farbe von der vorherigen Farbe abschält. Da nutzt das Anschleifen leider nichts, man sollte sich daher immer vorher darüber informieren, was man zum Überstreichen verwenden kann.
Sofern man die intakte Altfarbe gründlich gesäubert hat und dabei einen Fassadenreiniger mit hohem ph-Wert benutzt hat, erreicht eine deutlich bessere Oberflächenstruktur im Altanstrich, als es ein Schleifpapier jemals erreichen wird. und zu guter Letzt ist das Schleifen ja auch nur dort möglich, wo das Holz glatt (geschliffen/gehobelt) ist. Eine sägeraue oder feingesägte Holzoberfläche kann nicht angeschliffen werden...
Anders gesagt: wer sich schon Mal die Fingernägel lackiert hat, hat dieses vermutlich mit zwei Schichten Nagellack gemacht. Wird zwischen den beiden Schichten Nagellack zwischengeschliffen?
Wenn das Anschleifen einer intakten Altfarbe einen Sinn ergibt, dann auf Fußböden. Dort entstehen recht hohe Belastungen durch Druck (Möbel) und Abrieb. Just hier ist die aufgeraute Bodenschicht ein geeigneter Untergrund für einen Renovierungsanstrich. Diese Belastungen haben wir nicht auf der Fassade oder im Bereich von Fenstern und Türen. Wenn Sie also Spaß daran haben, Holzoberflächen zu schleifen, dann immer gerne auf Böden und Treppen vor einem Renovierungsanstrich.

Man muss nicht grundieren, weil die Grundierung schon enthalten ist
Das ist eine böse Falle, meistens mit Slogans wie "2-in-1" oder "3-in-1" behaftet. Die Hersteller solcher Produkte bringt sich im Wettbewerb in eine bessere Position, da die Aufmachung suggeriert, man könne mit weniger Anstrichen den gleichen Effekt erzeugen als andere Farben in der Auslage.
Dazu kurz erläutert, was Grundierung genau bedeutet - hier am Beispiel Holz im Außenbereich:
Streicht man eine Lasur oder Farbe auf das Holz, welches zumeist glatt / geschliffen / gehobelt ist, legt sich der Anstrich auf die Oberfläche wie ein Klebestreifen. Der Anstrich trocknet und hält - fürs erste. Weil Holz im Außenbereich durch wechselnde Luftfeuchtigkeiten dazu neigt, sich auszudehnen und wieder zu stauchen, kommt es zur Holzbewegung unter dem Anstrich. Dann verhält sich der Anstrich wie ein Streifen Tesafilm auf dem Handrücken. Durch die Bewegung des Holzes kommt es an der Oberfläche zur Ablösung bzw. zum Abblättern des Anstrichfilms. Ja, auch Lasuren blättern dann ab.


Die Bewegung des Holzes lässt sich eindämmen, indem das Holz eine Sättigung erfährt. Das geschieht in vielen Fällen mit einem s.g. Grundieröl, was im Holz wie eine Hautcreme fungiert und Risse bzw. Austrocknung hemmt. Insbesondere altes und sehr trockenes Holz wird damit 1-3x eingelassen, denn sonst wird die Farbe oder Lasur in dieser Vielzahl gesdtrichen, weil das Holz so stark saugt. Dann wird es jedoch teuer.
Bei einer deckenden Farbe ist die Masse an der Holzoberfläche größer als bei einer Lasur, der Anstrich ist dicker. Hier verwendet man nach dem Grundieröl einen s.g. Sperr- und Haftgrund, der im Gegensatz zu einer dicken Farbe in die Holzoberfläche eindringt und darin liegen bleibt. Das Verfahren erinnert stark an Butter oder Margarine auf einer Brotscheibe. Kommt dort die Käsescheibe drauf, klebt sie ein wenig an der Oberfläche der Brotscheibe fest. Eine deckende Farbe verbindet sich so mit an dem Haftgrund, der im Gegensatz zu einer Farbe ein wenig ins Holz eingedrungen ist.
Es verhält sich dann wie ein Klettverschluss, wo beide Seiten (Haftgrund und der Farbanstrich) sich in ihre Rauhigkeit legen und verbinden. Wenn eine Seite des Klettverschlusses glatt wäre, würde dieser nicht schließen, sich nicht verbinden.
Wie schon oben erwähnt, müssen Holzanstriche eine Verbindung mit dem Holz eingehen. Nur ganz wenige Anstrichtypen können das von alleine, wie z.b. reine Leinölfarbe oder Nadelholzteer. Alle anderen Anstricharten bleiben, insbesondere auf glatten Holzoberflächen, nur angetrocknet mit geringer Standzeit.
Holz muss atmen, der Anstrich muss offenporig sein
Dieses Thema wird insbesondere im deutschsprachigem Raum immer wieder heiß diskutiert. Dabei gibt es zu der obigen Aussage sicherlich eine persönliche Meinung, allerdings liegt hier eine physikalische Gesetzmäßigkeit vor. Dieses wollen wir hier kurz erklären:
Schutzanstriche für Metall, Putz oder Holz haben einen Zweck. Für manche ist es nur der Farbton zum "hübsch machen", für andere ist es der Schutz vor Widrigkeiten wie allgemein gesprochen Wind&Wetter. Für manche ist beides wichtig.
Metall mag nicht nass werden, sonst kommt es dazu, daß er rostet. Aus diesem Grund werden u.a. Autos mit deckender Farbe lackiert - wasserdicht. Wo ein Farbanstrich unerwünscht ist, wird mit Metallen gearbeitet, die unempfindlich gegenüber Wasser sind. Das wären z.B. Aluminium, Zink oder Kupfer, die bestenfalls mit der Zeit etwas anlaufen.
Putz enthält Salze, Salze binden Feuchtigkeit. Streicht man eine Putzfassade, müsste diese ringsherum in wasserundurchlässiger Farbe gestrichen werden, damit der Putz niemals feucht wird. Wird Putz feucht, kann es bei Forst zu Frostrissen kommen oder es kann sich Schimmel bilden. Da man Putzfassaden aber nicht ringsherum einstreichen kann, wird offenporige Farbe verwendet, die Feuchtigkeiten in beide Richtung hinein und wieder heraus lässt. Nasser Putz im Außenbereich trocknet allerdings sehr rasch, weswegen hier empfohlen wird, nicht diffusionsdicht zu streichen. Darum sind Putzfarben auch matt, also wasserdurchlässig.

Und wie sieht es beim Holz aus?
Wenn Holz nass wird, können wir beobachten, daß sich Keime am Holz guttun. Mittel- bis langfristig führt das zur Fäulnis, wenn die Feuchtigkeit verbleibt. Immer wiederkehrende Feuchtigkeit gefolgt mit einer erneuten Trocknung ist auch nicht so gut, da das Holz dadurch auslaugt.
Wenn Holz auslaugt, wird es sehr rissig. Ebenso rissig wie bei menschlicher Haut, wenn diese im Wasser austrocknet.
Holz hat keine Lunge, es atmet daher nicht. Fragt man diejenigen, die "atmungsaktiv", "offenporig" oder "diffusionsoffen" als Begriffe in den Mund nehmen, was das bedeutet, bekommt man meistens zu hören, daß das Holz "seine Feuchtigkeit abgeben muss". Wie die Feuchtigkeit ins Holz gekommen ist, wird hingegen nicht oder falsch beantwortet.
Wenn eine Holzfarbe atmungsaktiv/offenporig/diffusionsoffen ist, lässt sie Wasser bzw. Wasserdampf durch die Farbschicht hindurch - in beide Richtungen. Wenn es im Holz trockener als an der Außenluft ist, geht die Feuchtigkeit rein, sonst umgekehrt wieder heraus. Ist das Holz einmal nass geworden, weil der Anstrich offenporig ist, kommt es bei trockener, warmer Luft auch wieder heraus. Aber wann ist es denn wieder trocken? Von Oktober bis April ist es in Deutschland überwiegend feucht. Nässe von Oktober bleibt dann bis April im Holz - zum Glück war der Anstrich offenporig, damit das Wasser ein halbes Jahr im Holz verbleiben kann?!
Ein offenporiger, atmungsaktiver Anstrich ist in etwa das gleiche wie eine Regenjacke mit tausenden kleiner Löcher. Die Nässe kann dann durch die Jacke hindurch, kann aber danach wieder nach draußen entweichen.
Man stelle sich bloß vor, daß frühere Holzboote am Rumpf mit offenporiger Farbe gestrichen worden wären - damit die Nässe wieder aus dem Holz kann. Nun denn, wer es glauben mag, das Märchen von der offenporigen Holzfarbe...
Die Aussage, daß "das Wasser aus dem Holz entweichen kann", wenn der Anstrich offenporig ist, wurde leider nicht zu Ende gedacht sondern schlicht von anderen nachgeplappert. Man streicht ja kein nasses Holz, hat man noch nie gemacht. Wenn man nasses holz hat, dann nur durch zuvor eingedrungenes Wasser durch den offenen Anstrich.
Offenporige Anstriche sind meistens matt. Matte Oberflächen leiten die Feuchtigkeiten nicht ab sondern hinein. Glanz, wie beim Autolack, lässt die Nässe außen vor.
Atmungsaktiv - Offenporig - das verkauft sich gut, denn es hat einen positiven Klang. Dem Holz nutz es nicht, es wird nass. Dann besser nichts streichen, damit keine Staunässe im Holz entsteht.
Oder eine offenporige Farbe mehr als einmal streichen, da diese dann zumeist nicht mehr offenporig ist.
Je hochwertiger das Holz, desto länger hält es
Holz ist ein nachhaltiger Baustoff, der immer häufiger verwendet wird. Sei es der Zaun, das Wohn- oder Gartenhaus oder die Terrasse:
Immer mehr Menschen setzen auf Holz.
Dabei schauen viele auch auf die Holzart, die zum Einsatz kommen soll. Kiefern- und Fichtenholz sind die Klassiker. Heimisch, leicht im Gewicht und preiswert. Diese beiden Nadelholzarten werden immer häufiger durch Douglasien- oder Lärchenholz abgelöst. Diese Nadelholzarten sind etwas robuster und haben eine höhere Dichte (Masse) als Kiefer/Fichte. Da sie zumeist auch etwas teurer sind, wird hier die Auswahl beeinflusst und das "bessere" Holz gewählt.
Die hier abgebildete norwegische Stabholzkirche ist etwa 800 Jahre alt, das damals verwendete Material war harzreiches Kiefernholz, welches mit dem damals typischen Nadelholzteer eingestrichen wurde. Bis heute sind 25-30% des Holzes noch original aus der Zeit der Erbauung.
Weiches Holz wie die Kiefer oder Fichte wurde auch beim Bau der Schiffe eingesetzt, mit denen die Wikinger über Grönland bis in den Nordosten Nordamerikas gelangten.
Auch diese Hölzer sind damals mit Nadelholzteer eingelassen worden und haben als archäologische Funde eine teilweise erstaunliche Unversehrtheit.
Wer auf hochwertigere Holzarten setzt, macht nichts falsch - sofern man diese nicht sofort mit etwas einstreicht. Die dichteren Hölzer wie Douglasie, Lärche, Eiche oder gar viele Tropenhölzer nehmen anfänglich keinerlei Flüssigstoffe an. Regen perlt sehr lange am unbehandelten Holz ab, Parasiten meiden den höheren Harzgehalt. Wird das neue Holz jedoch sofort gestrichen, trocknen Anstriche nur auf der Oberfläche an, ziehen aber nicht ins Holz ein. Diese höherwertigen Holzarten sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn man eine längere Zeit ohne einen Anstrich auskommen will. Anders gesagt:
Je hochwertiger das Holz, desto länger kommt es ohne Schutzanstrich aus.
Weil in den Baumärkten und leider auch in vielen Fachgeschäften nicht nach der zu streichenden Holzart gefragt wird:
wer hier eine acrylhaltige Farbe angeboten bekommt und diese zu früh und ohne passende Grundierung verstreicht, kann beim Verrotten des teuren Holzes regelrecht zusehen.
Wie lange ein Holz geschützt bleibt und seinen Zweck erfüllt, hängt einzig von der richtigen Behandlung ab. Eine gute Behandlung kann daher auch jene sein, die "keinen Anstrich" bedeutet.


Wasserbasierende Farben sind ökologisch
Es gibt heute im Wesentlichen drei Arten von Lösemitteln. Da wäre einerseits Terpentin oder auch Balsamterpentin genannt, welches ein rein pflanzliches Lösemittel ist. Dieses Lösemittel wird heute noch in pflanzlichen Anstrichen wie u.a. dem Nadelholzteer benutzt.
Terpentinersatz ist hingegen ein mineralisches Lösemittel und kommt in einigen Lasuren und Farben vor, die das Bindemittel Alkydharz oder auch ein pflanzliches Öl wie Leinöl enthalten. Es nennt sich Terpentinersatz, weil es früher das preiswertere Ersatzprodukt gegenüber dem Balsamterpentin war.
Wasser ist ebenfalls ein Lösemittel, welches vorwiegend bei Farben & Co. zur Verwendung kommt, die das Bindemittel Acryl oder Acrylat enthalten (beides Plastik). Auch Alkydharze und pflanzliche Öle werden inzwischen in Wasser gelöst.
Was alle diese Lösemittel eint, steht auch im Begriff "Lösemittel":
Sie lösen sich aus dem Anstrich während der Trocknung.
Wasser wechselt sehr rasch aus einem Anstrich, wenn die Umgebungsluft trocken genug ist. Terpentinersatz benötigt unter den gleichen Bedingungen ein wenig länger. Beide Lösemittel entziehen sich dem Anstrich jedoch vergleichsweise schnell und vor allem restlos. Balsamterpentin ist langsamer in der Ausdunstung, da Öle enthalten sind, die schwerer flüchtig sind.
Ist das Lösemittel entwichen, bleibt ein getrockneter Anstrich auf der Oberfläche. Das gesunde Wasser ist nun abgezogen, der ungesunde Terpentinersatz bzw. Balsamterpentin ebenso. Was bleibt?
Wer bis hier dachte, daß wasserbasierende Anstriche die gesünderen und ökologischeren bzw. nachhaltigeren sind, sollte besser auf die weiteren Inhaltstoffe schauen, die am Ende verbleiben und sich "Schutzanstrich" nennen.
Acryl bzw. Acrylat ist Plastik und zerfällt im UV-Licht der Sonne zu Mikroplastik. Dieses gelangt im Außenbereich über das Grundwasser in die Flüsse und Ozeane. Man nimmt an, daß 60% des Mikroplastiks in den Weltmeeren aus der Farbenindustrie stammt.
Konservierungsmittel sind wichtig, damit das Wasser in einer Farbe nicht Keime anzieht. Diese Konservierungsmittel sind jedoch allergen und dunsten Wochen bis Monate nach der Trocknung des Anstrichs weiter aus - und man riecht es nicht einmal.


Bis zu 50 verschiedene Stoffe der chemischen Art befinden sich in den Anstrichmitteln auf wasserbasis, die uns suggerieren, daß Produkt sei gesund oder unbedenklich. Der Blaue Engel als Gütesymbol verschlimmbessert das Ganze. Direkt neben dem Symbol steht zwar zumeist, welche Gefahren das Produkt mit sich bringt. Aber wer liest sich noch Texte durch, die keine Gebrauchanleitung sind? Anstriche, die Terpentin oder Terpentinersatz als Lösemittel enthalten, sind auch nicht gesund. Diese Lösemittel können Atemwege erreichen und Allergien, Reizungen oder Kopfschmerzen, Übelkeit bis hin zu Benommenheit bewirken, Hautreizungen sowie das Austrocknen der Haut sind bei Kontakt weitere Risiken. Das kann bei uns Menschen während der Verarbeitung sowie der danach folgenden Trocknung passieren. Danach dunstet aber nichts mehr aus und ein Hautkontakt erfolgt hier ohne Reizungen, da nur noch das Bindemittel, das Pigment und bei Außenfarben auch noch Algizide im Anstrich sind. Die giftigen Substanzen sind entwichen.
Weißes Pigment Titandioxid ist giftig/krebserregend
Weißes Pigment hat eine Besonderheit:
es ist entweder ungesund bzw. sogar giftig oder es ist von schlechter Deckkraft. Bisher hat man nichts gefunden, was als weißes Pigment unbedenklich und zeitgleich mit hoher Deckkraft versehen ist.
Früher gab es Bleiweiß (Bleihydroxidkarbonat), welches hochdeckend und stark antiseptisch gegen organischen Bewuchs ist. Durch seine Giftigkeit ist es heute in Farbanstrichmitteln verboten.
Eine Alternative war schon sehr lange das Zinkweiß (Zinkoxid). Es deckt jedoch schwächer als Bleiweiß und ist bei Hautkontakt reizend, daher nicht mehr in Verwendung als alleiniges Pigment in Anstrichmitteln, bestenfalls noch als Zusatz.
Heute wird überwiegend Titandioxid verwendet. Dieses Pigment ist jedoch vor einigen Jahren in Verruf geraten, da es nach Analysen im Verdacht steht, krebserregend zu sein.


Nun sollte man wissen, daß Titandioxid seit über 60 Jahren als Färbestoff in Lebensmitteln zugelassen ist. Erkennbar war es unter der Bezeichnung E 171. Viele Produkte des alltäglichen Lebens enthielten Titandioxid als Aufheller, u.a. auch Zahnpasta oder so mancher Käse. Seit dem Jahr 2022 ist der Zusatz in Lebensmitteln jedoch nicht mehr zulässig.
Fakt ist jedoch:
Titandioxid ist vermutlich in Pulverform gefährlich, da die einzelnen Partikel eine Größe im Nanobereich besitzen. Dieses kann für die Atemwege ein Risiko darstellen. Farbe ist jedoch anfangs flüssig, später fest. Erst durch das Schleifen von Farbschichten können wieder kleinere Partikel entstehen.
Diese Information rund um das Pigment Titandioxid schwappte damals auch in die Welt der Anstrichmittel über, da Farben auch weiß sein können und eben jenes Pigment enthalten.
Da auch Verpackungen wie z.B. Joghurtbecher dieses Pigment enthalten, ist das Gefahrenpotenzial des Titandioxids bei Farbanstrichen weitaus geringer als bei anderen Dingen des alltäglichen Lebens.
Lieber zu dick als zu dünn streichen
Streicht man Butter oder Margarine auf das Brot, folgt man entweder seinem Geschmack oder sieht es funktional als Haftmittel für die Käsescheibe.
Wie dick darf den das Streichfett aufgetragen werden?
In diesem Fall hat sicherlich jeder seine eigene Vorliebe bzw. verzichtet sogar darauf.
Streicht man hingegen Holz- oder Putzoberflächen im Außenbereich, ist die Schichtstärke des Anstrichs von Relevanz. Denn:
je dicker die spätere Farbschicht, desto eher kann ist im Laufe der Zeit auch zu Spannungsrissen kommen.
Farben mit einem Gütesiegel oder Verarbeitung nach DIN sind die besseren Produkte
Was ein Gütesiegel wie z.B. der blaue Engel oder eine Normierung wie nach DIN über einen Anstrich aussagt, wird beim Kauf gerne in die Kaufentscheidung eingebunden - ungeprüft. Wir in Deutschland sind es gewohnt, daß alles seine Ordnung hat und für alles eine Prüfung statt findet oder eine Vorgehensweise festgelegt wurde. Das ist auch gut so.
Leider ist ein Anstrich mit Farbe auf einer Oberfläche nicht normierbar. So haben z.B. Holz und Farben bzw. Öle sowie Lasuren bestimmte Eigenschaften. Wie schon weiter oben zum Thema "wasserbasierende Anstriche sind gesund" erklärt, gibt es Bindemittel in allen Anstrichen. Diese müssen sich miteinander bzw. übereinander vertragen, damit Anstrich 1 und Anstrich 2 sich nicht bald wieder voneinander trennen.
Woher weiß eine Normierung, was vorgestrichen war? Welche Bedingungen beim Streichen gegeben sind, muss der Maler vor Ort bestimmen. Alles andere ist ein "Beschichten", was ausgenommen bei Autolacken nie gut funktioniert.
Wer es sich als Hersteller leisten kann:
Eine Normierung wie nach DIN oder eine Gütezeichen wie der blaue Engel werden nicht verliehen sondern gekauft.
Die Verarbeitung eines Anstrichs nach DIN ist ein inzwischen existierender Protektionismus in Deutschland, damit sich Betriebe gegen andere europäische Produkte erwehren können. Es geht dann nicht um die höchste Qualität oder das am besten passende Produkt.
Wir erleben es gelegentlich, daß die Denkmalpfleger bei denkmalgeschützten Bauten vor einem Renovierungsanstrich auf den Farbton des Anstrichs größten Wert legen. Das Produkt "Farbe" spielt dabei keine Rolle, es geht nur um den Farbton und es wird sogar mit Acrylfarbe gestrichen. Das hat weder etwas mit Denkmalschutz noch mit Nachhaltigkeit zu tun.